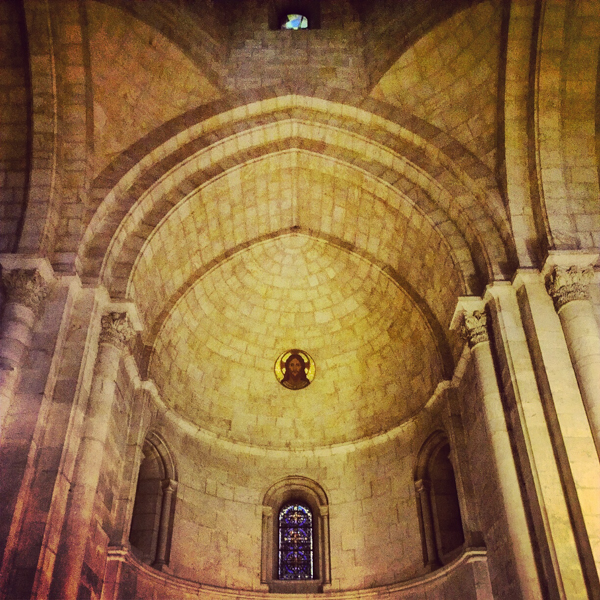Jordan, 2015

Rico Grimm
text. social media. moderation. foto.



Wenn die Bärte länger, die Hüte eigenartiger, die Gewehre größer und die Kuppeln goldener werden, wenn die Gassen enger, die Straßenbahnen voller, die Mitbewohner französischer und die Steine weißer werden, wenn Hügel sanfter rollen, Taxifahrer lauter schimpfen und die Sonne klarer scheint, dann weißt du, dass du wieder in Jerusalem bist. Hallo!

In dem großartigen Hamburg-Epos „Soul Kitchen“ gibt es eine Szene, in der ein Koch kündigt, in dem er mit seinem Messer einen Zettel an die Restaurant-Tür nagelt. Auf dem Zettel steht: „Der Reisende ist noch nicht am Ende, er hat das Ziel noch nicht erreicht.“
Dieser Koch könnte Gunter sein. Er betreibt ein deutsches Restaurant im Irak, genauer: in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan. Als ich nach mehr als einem halben Jahr im Nahen Osten bei ihm ein Bier bestellte, war das ein bisschen als würde ich zurückkehren in die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Seine Speisekarten waren schwarz, ein buntes, vertrautes Logo darauf. Die Brauerei, die sie geliefert hatte, habe ich oft gesehen, wenn ich als Junge mit meinen Eltern einen Fahrradausflug gemacht habe. Das Essen, das er anbietet, kannte ich von meiner Oma.
Gunter kommt aus Tabarz, einem Örtchen in Thüringen, dem gleichen Bundesland, aus dem ich auch stamme. Dass er mal Thüringer Klöse im Irak kocht, war alles andere als klar als er im Herbst 1989 einmal „spazieren“ ging, also demonstrieren war. Zur Rache berief ihn die DDR-Regierung in die Nationale Volksarmee ein, ein paar Wochen später fiel die Mauer und Gunter fand sich in einer Armee wieder, die gerade noch den Klassenfeind im Westen bekämpfen sollte, aber nun dabei war, die Vereinigung mit der Bundeswehr zu vollziehen. Gunter blieb. Er machte das, was er gelernt hatte. Er kochte. Auf dem Balkan, dann in Kabul – dort schließlich eröffnete er seinen ersten Deutschen Hof. Es lief gut bis es zuviele Anschläge gab. Gunter schloss ab und flog nach Hause. 30.000 investierte Euro waren weg. Neuer Versuch in Erbil, Irak. Bald auch auf Sri Lanka.
Als ich mit Gunter sprach, merkte ich, dass er nicht wieder in Deutschland leben kann. Draußen in der Welt, da kann er wer sein. In Deutschland wäre er nur ein ehemaliger Bundeswehr-Koch. Als ich ihn nach Deutschland frage, fragt er zurück: „Was will ich denn da?“

Im palästinensischen Protestdorf Bab Al-Karama, Beit Iksa, Januar 2013. Im Hintergrund bauen zwei Männer eine provisorische Moschee.


Ich wollte Wadi Musa vom Dach unseres Hostels fotografieren während die Sonne untergeht – es war ein eher langweiliges Setting. Dann entdeckte ich diese Lampe und je länger ich sie betrachtete, schien sie mir völlig aus der Szenerie gefallen zu sein. Sie erinnerte mich in ihrer Klarheit an Bauhaus-Design. In diesem Bild wollte ich beides verschmelzen: dessen Kühle und die Hitze der Wüste.

Ich hatte die Siedlung Kfar Etzion besucht, um einen Dichter für Zeit Online zu porträtieren, einen wirklich erstaunlichen Mann. Denn Eliaz Cohen ist so etwas wie ein linker Siedler, hört sich verrückt an, aber unsere europäischen Begriffe von rechts und links greifen in Israel nicht immer. Denn Cohen sagte, dass er das Westjordanland nicht verlassen werde, das sei biblisches Land. Er sagte aber auch: Israel wird heruntergewirtschaftet, sein sozialistisches Erbe verschleudert, die Textur der Gesellschaft sei zerrissen. Dieses Land brauche eine soziale Erneuerung, weniger Iran und Rassismus, mehr Wohnungsbau und Toleranz. Wir sprachen letzte Woche miteinander und Cohen konnte über die Wahlen nur bitterlich lachen. Diese Woche allerdings zog Yair Lapid völlig überraschend mit 19 Sitzen in die Knesset, das israelische Parlament, ein. Sein Kernthema: Stärkung der Mittelschicht, wenn auch der nicht-religiösen. Und vielleicht ist das die Botschaft dieser Wahlen: Pessismus ist in Israel Alltagsware; der Friedhof der Hoffnungen ist groß. Aber deswegen muss niemand fatalistisch sein.